MEIN JOB BIBLIOTHEK: Infos & Materialien für Bibliotheken zum Herunterladen & Verwenden
Ende 2023 wurde das Webportal meinjob-bibliothek.de online gestellt und bis zum 31. März wurde es bereits 31.500 Mal aufgerufen. Es bietet umfassende Informationen für alle, die sich für die spannende Welt der Bibliotheken als Ausbildungs- und Arbeitsplatz interessieren. Weiterlesen
Künstliche Intelligenz für das Publikationsmanagement
Plattformen wie BibSonomy.org unterstützen Forschende beim Finden und Organisieren von Literatur. In der Informatik der Uni Würzburg wurde nun ein Tool entwickelt, welches diese Vorgänge noch weiter vereinfachen könnte. Weiterlesen
Zeitschriften in die Schulen – Mit „Bravo“ und „Bike“ für das Lesen begeistern
Zu viele Kinder verlassen die Grundschule ohne richtig lesen zu können. Das Projekt „Zeitschriften in die Schulen“ will Schülerinnen und Schüler für das Lesen begeistern. Weiterlesen
Bewerbungsstart für Gütesiegel Buchkita: Börsenverein und DBV prämieren frühkindliche Leseförderung
Noch bis zum 31. Mai können sich Kindertagesstätten für das „Gütesiegel Buchkita“ bewerben. Der Illustrator ist Paul Maar ist Schirmherr der Aktion. Verliehen wird das Gütesiegel auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Weiterlesen
Neues Ausleihangebot der LBZ-Ergänzungsbücherei: Wir gehen auf die “Lesewiese”
Im Frühling vergrößert das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) sein Ausleihangebot für Öffentliche Bibliotheken und Kitas: Die „Lesewiese“ ist eine sehr intensive neue Methode der Sprach- und Leseförderung, die sich gezielt an Kita- und Krippenkinder von 1-3 Jahren richtet. Weiterlesen
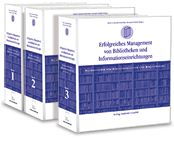


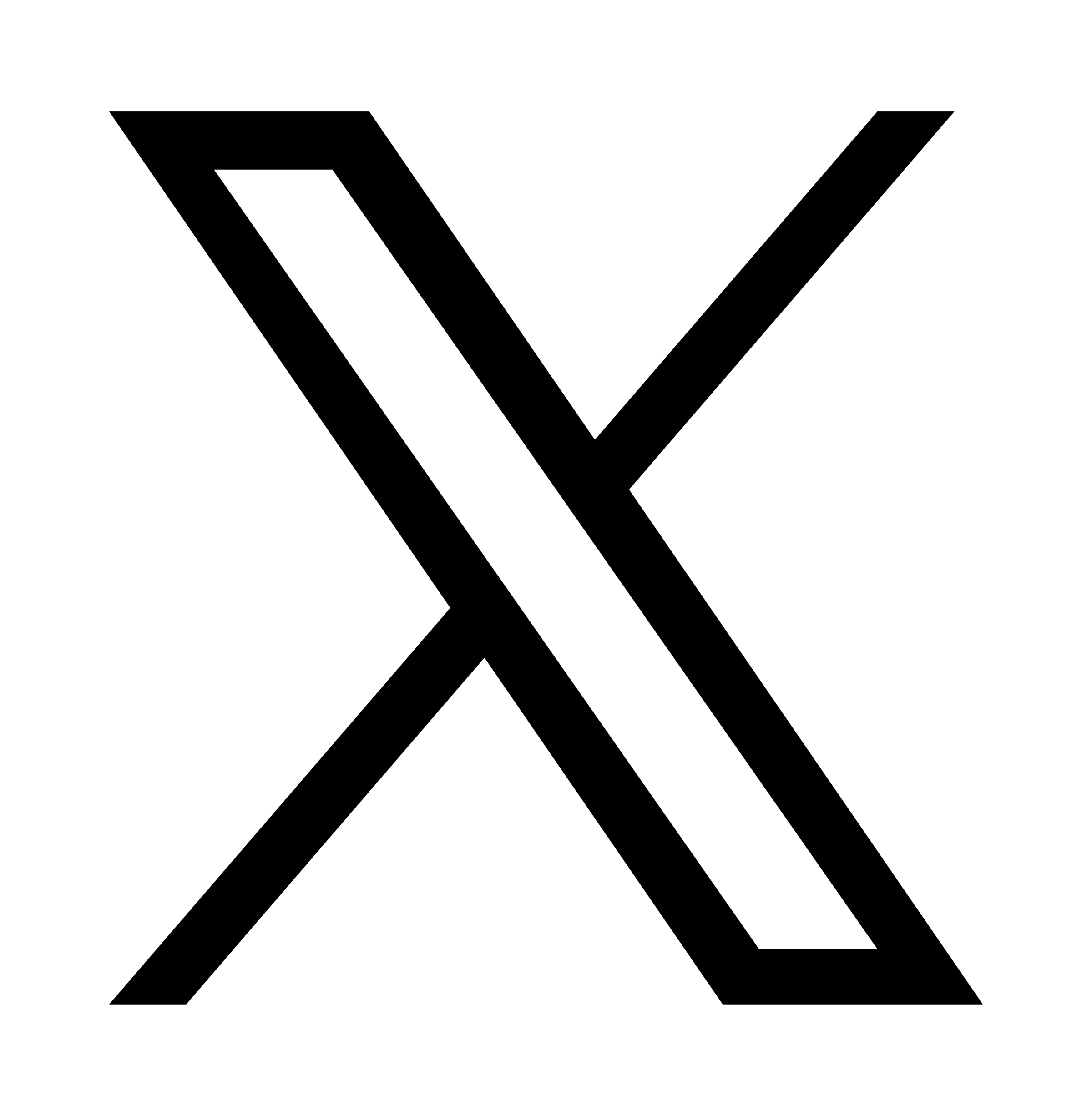 X
X
