Zugang zu Büchern stärkt Informationskompetenz
Am 23. April feierten Bibliotheken, Buchhandlungen, Schulen und Literaturhäuser mit zahlreichen Veranstaltungen und Lesungen den Welttag des Buches und damit den Zugang zu Literatur, Informationen und Medien. Weiterlesen
Bibliothek des Goethe-Instituts in der Ukraine wieder geöffnet
Die Bibliothek des Goethe-Instituts in Kyjiw ist seit letzter Woche wieder für Publikum geöffnet und die Ausleihe erstmals seit Beginn der Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt wieder möglich. Die Auftaktveranstaltung für Kinder und Familien am Wochenende war gut besucht. Weiterlesen
Welttag des Buches 2024: Über 1,1 Millionen Schulkinder in ganz Deutschland erhalten Buchgeschenk
Teilnahmerekord: Mit rund 50.600 Klassen nahmen so viele Schülerinnen und Schüler an der 28. Ausgabe von „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum diesjährigen Welttag des Buches teil wie noch nie. Weiterlesen
Woche der Meinungsfreiheit 2024: Vielfältiges Programm für Demokratie, Debatte und Frieden
Ein Netzwerk von mehr als 70 Partnern vereint sich für die „Woche der Meinungsfreiheit“, die vom 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, bis zum 10. Mai, dem Jahrestag der Bücherverbrennungen stattfindet. Weiterlesen
Deutscher Lesepreis 2025: Projekte zur Leseförderung können sich jetzt bundesweit bewerben
Leseförderungsprojekte mit Vorbildcharakter – ab sofort können sich zum zwölften Mal Einzelpersonen, Einrichtungen, Schulen, Kitas und digitale Vorreiter für den Deutschen Lesepreis 2025 bewerben. Der Preis gibt herausragendem Engagement in der Leseförderung eine prominente Bühne und ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Weiterlesen
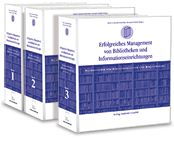


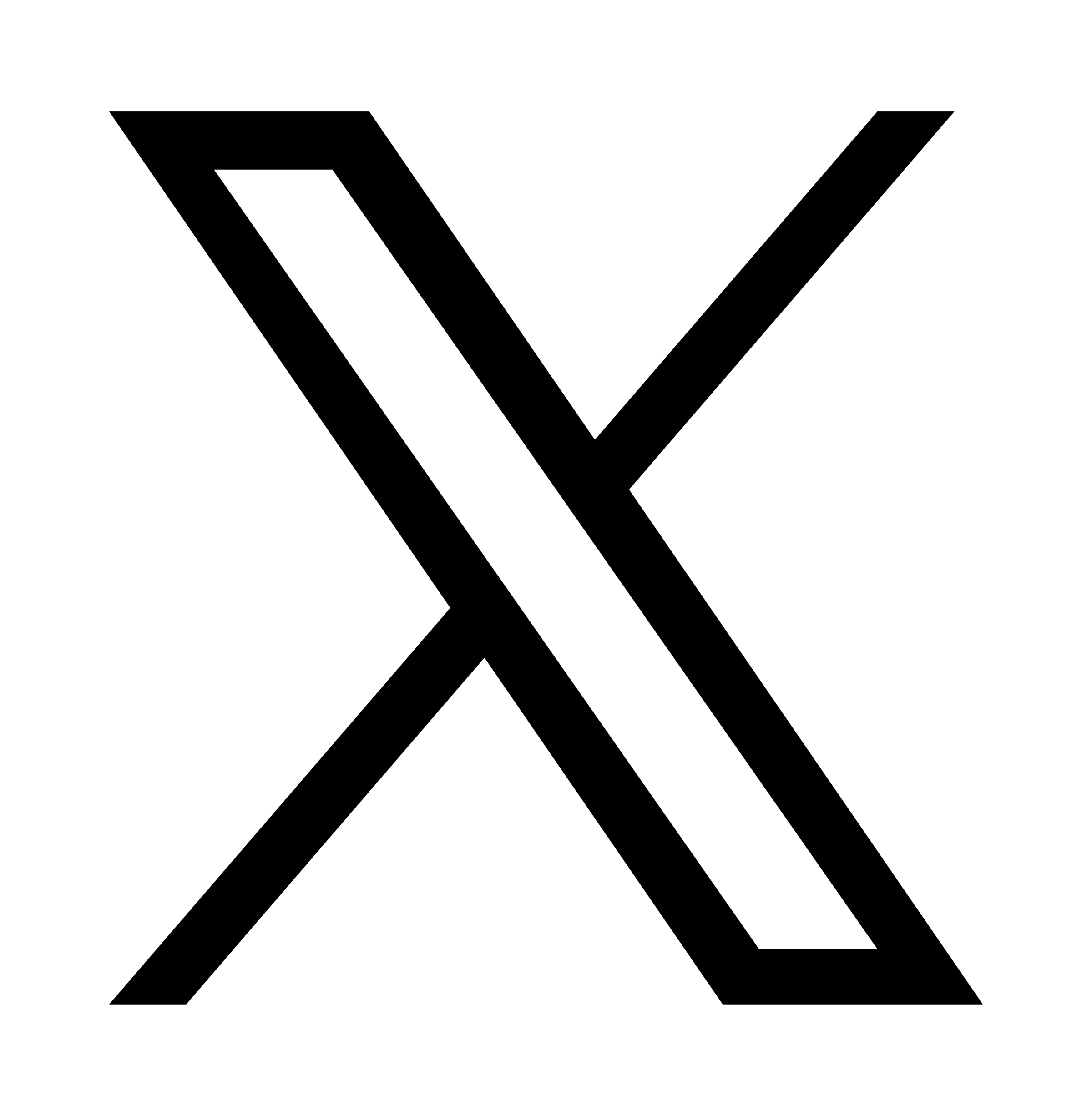 X
X
